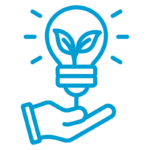Forschungsprogramm: DDI – Digitale demokratische Innovationen

Das DDI-Team ist daran interessiert, wie sich die Demokratie in einer digitalen Gesellschaft verändert und wie man sie durch Digitalisierung fördern kann. Die empirischen Schwerpunkte des Programms liegen dabei auf den politischen und sozialen Effekten von Smart-City-Projekten. In einem zweiten empirischen Themenfeld befassen sich die Forscher:innen mit der Entwicklung und dem Einsatz von Online-Abstimmungen und -Wahlen.

Wie verändern sich politische Entscheidungsfindung und gesellschaftliche Teilhabe unter den Bedingungen der Digitalisierung?
Wie verändern sich politische Entscheidungsfindung und gesellschaftliche Teilhabe unter den Bedingungen der Digitalisierung?
Digitales Wählen und Abstimmen
Das Forschungsprogramm Digitale Demokratische Innovationen wurde im Oktober 2021 eingerichtet und hat mit den Themen „Smart City“ und „Digitales Entscheiden“ zwei Arbeitsbereiche strukturiert, die in der Projektlaufzeit bis 2026 die wesentlichen empirischen Ankerpunkte der gemeinsamen Forschung darstellen. Zunächst stand dabei die Organisation der interdisziplinären Zusammenarbeit im Vordergrund – wie können Forschende aus so unterschiedlichen Feldern wie Architektur und Stadtplanung, Politikwissenschaft, Philosophie, Kommunikationswissenschaft und Psychologie sinnvoll kooperieren? Ausgehend von einer Bestandsaufnahme von Smart City-Projekten im Ruhrgebiet sind dabei erste Konferenzbeiträge und Publikationen entstanden, die sukzessive um internationale Perspektiven und praxisbezogene Einblicke erweitert werden.
Smart-City-Konzepte
im Ruhrgebiet
Prof. Dr. Christoph Bieber

Leiter Forschungsprogramm DDI
christoph.bieber@cais-research.de
Direkt zu …
Forschungsbereiche
Smart-City-Konzepte im Ruhrgebiet: Eine Bestandsaufnahme (2022)
Ganz praktisch lösen ließen sich diese Fragen bei der gemeinsamen Bestandsaufnahme von Smart-City-Projekten im Ruhrgebiet. Dabei haben die Forschenden zunächst Einzelportraits von elf Großstädten in der Region angefertigt und die Besonderheiten der jeweiligen Smart City-Konzepte herausgearbeitet. Bei der Sichtung des Materials hat sich gezeigt, dass jede Stadt nach ihren eigenen Schwerpunkten und Zielsetzungen handelt – eine konsistente öffentliche Diskussion über das „Ruhrgebiet als smarte Region“ gibt es derzeit nicht. Zudem existiert auch keine Übereinkunft darüber, was „Smart Cities“ nun eigentlich ausmacht. Bei der Erarbeitung von „Stadtportraits“ ließen sich mehrere „Themen“ oder „Narrative“ ableiten, die eine Akzentuierung der urbanen Modellprojekte anleiten: das sind zum Beispiel neue Formen von Bürgerbeteiligung, Experimente mit Künstlicher Intelligenz, „grüne Innovationen“ in der Smart City sowie daten-gestützte Mobilitätskonzepte. Ungeklärt bleiben jedoch wichtige Fragen hinsichtlich der politischen Verfahrensläufe und der Verantwortlichkeit in den Modellprojekten. Schließlich ist auch unklar, wie sich die verschiedenen Smart Cities im Ruhrgebiet zueinander verhalten – denkbar sind verschiedene Konstellationen, von der produktiven Kooperation über den direkten Wettkampf hin zum Ignorieren der benachbarten Projekte.
Und was geschieht anderswo? Das Beispiel Los Angeles (2022)
Parallel zur regionalen Bestandsaufnahme durch das Team hat sich Christoph Bieber im Sommer 2022 mit den Smart City-Aktivitäten in Los Angeles auseinandergesetzt. Dort gelten unter dem Motto „Technology for a better L.A.“ insbesondere die Olympischen Spiele von 2028 als Treiber für innovative, datenbasierte Projekte. Im Rahmen seines Aufenthaltes im Thomas Mann House in Pacific Palisades hat er jedoch festgestellt, dass viele der Entwicklungen (zum Beispiel eine einheitliche Datenplattform oder eine Strategie zur ethischen Datenverarbeitung) durch die COVID-19-Pandemie aufgehalten und verzögert wurden. Eine überraschend große Rolle spielten dagegen datenbasierte Projekte im Kampf gegen die „housing crisis“ in der kalifornischen Metropole. Beispielsweise wurde die Nutzung von Zuschüssen für Vermieter großflächig ausgewertet und mit der Entwicklung der Obdachlosenzahlen abgeglichen. Zudem wurden Empfänger von Unterstützungsleistungen auf der Grundlage algorithmischer Verfahren ermittelt. Ähnlich wie bei der Bestandsaufnahme im Ruhrgebiet zeigte sich dabei, dass produktive stadtpolitische Maßnahmen nur im bereichsübergreifenden Zusammenspiel von Behörden, Gremien, städtischen Betrieben und externen Dienstleister gelingen können.
Das zweite Themenfeld: Digitales Wählen und Abstimmen (2023/24)
Im zweiten Projektjahr hat sich der Fokus in Richtung „digitaler Entscheidungspraktiken“ verschoben. Eine gute Illustration dafür liefert die im Frühjahr 2023 durchgeführte Online-Sozialwahl. In einem experimentellen Rahmen kamen bei einzelnen Krankenversicherungen digitale Abstimmungsverfahren zum Einsatz. Dabei wurde deutlich, dass digital gestützte Wahlvorgänge in Deutschland einen schweren Stand haben. Im Nachgang zur COVID-19-Pandemie scheint sich allmählich ein innovationsfreundlicheres Klima einstellen, denn viele politische Akteure wie Parteien, Parlamente und auch Städte haben durchaus gute Erfahrungen mit digitalen Abstimmungswerkzeugen gemacht. Die zögerliche Entwicklung in Deutschland kontrastiert das DDI-Programm mit Untersuchungen zur Europawahl (Juni 2024) und den US-Präsidentschaftswahlen (November 2024). Dabei wird auch die aktuelle Debatte um den Einfluss von KI-Systemen auf Wahlen aufgegriffen.
Digitale Ratssysteme: Keimzelle für Online-Entscheidungsfindung? (2023/24)
Im Herbst 2023 hat das DDI-Team die Nutzung „Digitaler Ratssysteme“ in Nordrhein-Westfalen untersucht. Diese Software-Anwendungen helfen Kommunalverwaltungen dabei, die Abläufe im Umfeld von Gemeinderatssitzungen zu automatisieren und die anfallenden Dokumente digital zu verarbeiten. Die Bestandsaufnahme zur digitalen Ratsarbeit in 73 eigenständigen Kommunen macht deutlich: Die Nutzung digitaler Ratssysteme zur Verbesserung interner Verwaltungsprozesse ist zum Standard geworden, auch in kleineren Gemeinden und über alle Landesteile hinweg. Im Vordergrund steht dabei die digitale Bürgerinformation, obwohl die eingesetzten Software-Plattformen auch bereits anspruchsvollere Nutzungsformen wie hybride Sitzungen oder digitale Abstimmungsverfahren erlauben. Aufgrund sehr restriktiver Regelungen zum Einsatz digitaler Technologie bei politischen Wahlen zeigt die kommunale Verwaltung mögliche Entwicklungspfade zur Verwaltungsmodernisierung auf.
Reallabore als urbane Experimentierfelder (2022/2023)
Es ist Ziel des CAIS, Arbeitsprogramme mit Blick auf anwendungsorientierte Forschung zu organisieren. Hierzu hat sich das DDI-Team mit dem Format des „Reallabors“ auseinandergesetzt, das aktuell als vielversprechendes Modell zur technologiebezogenen Feldforschung gilt. Reallabore sind Experimentierräume, in denen Wissenschaftler:innen und Vertreter:innen aus der Praxis zusammenarbeiten – etwa im Rahmen von Projekten, die entlang konkreter Fragen und Problemlagen gemeinschaftlich entwickelt und umgesetzt werden. Das Forschungsprogramm „Digitale Demokratische Innovationen“ setzt hier auf Kooperationen mit der Smart City Innovation Unit der Stadt Bochum und der Stadtverwaltung Oberhausen.
Wie geht es weiter?
Nach einer erfolgreichen Probephase zum “Forschen im Reallabor” werden konkrete Projekte weiter ausgearbeitet. Die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln in der Förderlinie „Transformationswissen für die Demokratie“ bei der Volkswagenstiftung erlaubt die Entwicklung neuer Formate zur Erforschung der Akzeptanz urbaner Innovationen. Außerdem begleitet das DDI-Team ausgewählte Städte beim Einsatz digitaler Informations- und Entscheidungssysteme bei der kommunalen Ratsarbeit.
Parallel zu den gemeinsamen Projektarbeiten verfolgen die beteiligten Team-Mitglieder ihre individuellen Qualifikationsprojekte. Erste Resultate der Arbeit an den Dissertations- und Habilitationsvorhaben werden kontinuierlich auf nationalen und internationalen Konferenzen vorgestellt. Zudem sind verschiedene Publikationen aus dem DDI-Zusammenhang veröffentlicht worden.
Im Jahr 2025 beteiligt sich das DDI-Team an der Organisation und Durchführung der internationalen CAIS-Konferenz, dabei ist die Umsetzung eines inhaltlichen Tracks entlang der Themen des Forschungsprogramms anvisiert.
Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte
Pop-Up Citizen Lab: Social Acceptance of Urban Innovations (2024/25)
Im Januar 2024 wurde im Rahmen der Förderlinie „Transformationswissen für die Demokratie“ ein auf 12 Monate ausgelegtes „Task Force“-Programm von der VolkswagenStiftung eingeworben. Gemeinsam mit der „Smart City Innovation Unit“ der Stadt Bochum als Praxispartnerin untersucht das DDI-Team dabei in einem experimentellen Setting, wie Bürger:innen die Einführung technischer Innovationen im städtischen Umfeld einschätzen. Als neuartiges Format werden dabei „Pop-Up Citizen Labs“ durchgeführt, bei denen Bürger:innen mit verschiedenen Szenarien konfrontiert werden, die eine Umsetzung von Smart City-Projekten simulieren. Dabei werden innovative Werkzeuge und Methoden eingesetzt und wichtige Daten zur Durchführung von kommunalen Beteiligungsprozessen generiert. Auf Grundlage dieser Erfahrungen lassen sich Handlungsempfehlungen entwickeln, die sowohl in der Stadt Bochum, wie auch im Rahmen weiterer Smart City-Projekte eingesetzt werden können.
Geplanter Projektstart ist der 1. April 2024, erste Resultate der „Task Force“ werden im November 2024 beim „Forum Transformationswissen über Demokratien im Wandel“ im Schloss Herrenhausen in Hannover vorgestellt.
Qualifikationsprojekte
Mapping the social acceptance of green innovation in urban spaces
Das Dissertationsprojekt trägt den Arbeitstitel „Mapping the social acceptance of green innovation in urban spaces“ (Kartierung der sozialen Akzeptanz grüner Innovationen im städtischen Raum) und bezieht seinen theoretischen Hintergrund aus den Bereichen Kommunikationswissenschaften, Mensch-Technik-Interaktion und Psychologie.
Politik und Künstliche Intelligenz
Das Promotionsprojekt setzt sich mit Fragestellungen auseinander, die das Verhältnis von Politik und Künstlicher Intelligenz thematisieren. Dabei stehen die deutschen Entwicklungen, verstanden als Teil eines politischen Mehrebenensystems, im Mittelpunkt der verschiedenen Beiträge.
Empathie in der Entscheidungsfindung: digitale versus nicht-digitale Kontexte
In dem Dissertationsprojekt „Empathie in der Entscheidungsfindung: digitale versus nicht-digitale Kontexte“ will Niklas Frechen die emotionalen und kognitiven Komponenten der Entscheidungsfindung im Vergleich zwischen analogen und digitalen Kontexten erforschen, wobei er einen besonderen Fokus auf Empathie legt.
Aktuelles
Research in the pop-up lab: Citizenship meets science. CAIS receives € 170,000 for transdisciplinary research project
Funding application to the Volkswagen Foundation successful: The CAIS research programme „Digital Democratic Innovations“ receives funding of 170,000 euros to implement innovative participation research in...
Forschen im Pop-Up-Labor: Bürgerschaft trifft Wissenschaft. CAIS erhält € 170.000 für transdisziplinäres Forschungsprojekt
Förderantrag bei der VolkswagenStiftung erfolgreich: Das CAIS-Forschungsprogramm „Digitale Demokratische Innovationen“ erhält Fördermittel in Höhe von 170.000 Euro zur Umsetzung innovativer Beteiligungsforschung in Kooperation mit der...
Digitale Ratssysteme: Nachrichten aus den Niederungen der Digitalisierung
Eine Bestandsaufnahme über die Verwendung von Digitalen Ratsinformationssystemen (DRS) in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens.
AIT’s Forum on the Histories of the Internet.
A talk at the AIT’s Forum about „The Internet of Things: Co-production for Inclusive Smart Cities.“
Christoph Bieber über Smart Cities
Sensoren und Technologie werden dafür sorgen, dass in Städten immer mehr Daten gesammelt werden.
Einführung in die Ethik. Grundmodelle der Ethik.
Am 20. Dezember 2023 wird Jana Baum eine Seminarsitzung zum Thema „Einführung in die Ethik. Grundmodelle der Ethik.“ leiten.
KI verbessert Gesellschaft?!
Christoph Bieber gestaltet einen Workshop zum Thema „Digitale Ethik“ während einer Tagung am 18. und 19 Januar an der Akademie für politische Bildung Tutzing.
Welchen Einfluss hat KI auf das Superwahljahr?
Über das kommende Superwahljahr 2024 und Einflüsse von Künstlicher Intelligenz spricht Christoph Bieber im Tagesschau-Artikel.
Zweites Special Issue der Transferzeitschrift easy_social_sciences erschienen
Das zweite Special Issue der Transferzeitschrift easy_social_sciences in Zusammenarbeit mit Julian Kohne (GESIS) und Johannes Breuer ist erschienen.
Sammelbandbeitrag „Wahlen sind auch nur ein Algorithmus“
Anne Goldmann und Christoph Bieber mit einem Beitrag zum Sammelband „Regieren in der Transformationsgesellscahft“ zum Thema Wahlen und Algorithmus.
Update: Smart City Summit Niederrhein
Christoph Bieber nimmt am Smart City Summit am Niederrhein teil. Der Termin hierfür hat sich von November 2023 auf Februar 2024 verschoben.
Workshop: Zukunft der Demokratie
Vom 13. bis 14. November nimmt Christoph Bieber am Workshop Zukunft der Demokratie in Barcelona (der aktuellen European Capital of Democracy) teil.
Lehrauftrag Medienforschung an der TU Dresden
An der TU Dresden führt Pauline Heger einen Lehrauftrag im Studiengang Medienforschung aus.
Interuniversitäre Nachwuchstagung Stuttgart
Jana Baum hält am 1.10. einen Vortrag zu der Frage, inwiefern Künstliche Intelligenz theoretisches Wissen besitzen kann am Beispiel des Computersystems „Apperception Engine“.
Präsentation auf der ECPR General Conference 2023
Am 8. September präsentierte Anne Goldmann zum Thema „AI in the German Bundestag“ auf der ECPR General Conference.
Presentation at the ECPR General Conference 2023
On 8 September, Anne Goldmann presented on „AI in the German Bundestag“ at the ECPR General Conference.
Podcast Episode „Digital Sensemaker“
Zur 100. Podcast Folge war Anne Goldmann zu Gast bei „Digital Sensemaker“ um über KI und Politik zu sprechen.
Hybrid Smartness
In this latest book chapter co-authored by Mennatullah Hendawy, the idea of smart cities is explored though different approaches of Top-Down and Bottom-Up.
Das (digitale) Leben ist eine Baustelle.
Christoph Bieber trägt in einer Sonderausgabe der „Digitalisierung und Politikuntericht“ mit einem Essay bei.
Unity & Primordiality of Reason
Jana Baum wird im Zusammenhang mit dem Workshop „Author Meets Critics“ mit Lea Ypi einen Vortrag an der Uni Leipzig halten.
Conference Presentation at the ICPP6
Jana Baum and Anne Goldmann will attend the ICPP6 to talk about their paper they worked on with Mennatullah Hendawy.
Impulsvortrag zur Situation der Gremienaufsicht in Deutschland
Auf einer Konferzen im Presseclub Concordia zur Unabhängigkeit des ORF im Wien nimmt Christoph Bieber mit einem Impulsvortrag teil.
Rationalitätsmodelle in der Klassischen Deutschen Philosophie
Jana Baum besucht im Rahmen des Arqus Netzwerks einen Workshop in der italienischen Stadt Padua zum Thema Rationalitätsmodelle.
Daten für die smarte Stadt und schon läuft‘s: Ist es wirklich so einfach?
Ob Verkehrsführung oder die Verbesserung des Klimas – durch Daten erscheint in einer smarten Stadt vieles steuerbar. Wir diskutieren die Herausforderungen für Smart Cities mit:...
Informative cartographic communication
Mennatullah Hendawy published a latest journal article with Ahmed Atia on COVID-19 and the geovisualization.
meine.deine.unsere.werte – Student Competition organized by Ruhr University Bochum (Professional School of Education)
On the 19th of June Christoph Bieber will be jury member at the reward ceremony for meine.deine.unsere.werte.
Seminar: Technology & Media Ethics at HdM, Stuttgart
From April to July 2023 students can take part in the seminar „Technology & Media“ by Christoph Bieber.
Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Am 20.04.2023 wird Christoph Bieber im NRW Parlament auf Fragen zum Thema „Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ beantworten.
Der mAI am CAIS: Lernen Sie unsere KI-Forschung kennen
Der Mai 2023 wird deutschlandweit zum KI-Monat. Am 17. Mai 2023 geben wir drei zentrale Einblicke in unsere KI-Forschung.
„Hauptsache Digitalisierung?“
Anne Goldmann mit ihrem Beitrag: „Hauptsache Digitalisierung? Zur Positionierung der Parteien im Bereich Digitalpolitik im Vorfeld der Bundestagswahl 2021“ jetzt verfügbar.
„Conception and Interpretation of Interdisciplinarity in Research Practice“
Journal Paper by Josephine Schmitt, Anne Goldmann, Samuel Simon and Christoph Bieber
„Conception and Interpretation of Interdisciplinarity in Research Practice“
Journal Paper by Josephine Schmitt, Anne Goldmann, Samuel Simon and Christoph Bieber
White Paper: KI & Journalismus
Im White Paper zu KI und Journalismus trägt Christoph Bieber als Co-Autor zur Plattform Lernende Systeme bei.
Transformation politischer Partizipation
Am 19. Januar 2023 haben sich Anne Goldmann, Pauline Heger & Christoph Bieber an einer Sitzung des Seminars „Transformation politischer Partizipation“ an der NRW School...
„Failed yet successful: Learning from discontinued civic tech initiatives“
Im Rahmen der CHI23-Konferenz beteiligen sich Mennatullah Hendawy und Christoph Bieber an der Durchführung eines Workshops. Eine Anfrage zur Mitarbeit kam aus dem Berliner Weizenbaum-Institut....
„Einführung in die Ethik. Grundmodelle der Ethik“
Im Rahmen des Seminars „Transparenz, Ethik und Öffentlichkeit in der (digitalen) Demokratie“, geleitet von Anne Goldmann an der Uni Duisburg/Essen, gestaltet Jana Baum am 14.12.2022...
„Ryle on voluntary actions“
Vom 3. bis 5.11.2022 fand die Konferenz „The End of Autonomy?“ an der Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) statt. Hierbei hielt Jana Baum...
Entfällt leider: „Ist das eine alte Hand?“ – Digitales Entscheiden und Online-Parteitage
Der Vortrag von Dr. Christoph Bieber an der Ev. Stadtakademie Bochum am 13.12.2022 muss leider entfallen. Vortragsinhalt: Die Corona-Pandemie hat bei den politischen Parteien einen...
„Digitalisierungspolitik“
WDR 3 Forum ist die maßgebliche Plattform für aktuelle kultur- und gesellschaftspolitische Fragen. Seien Sie live dabei, wenn kontroverse Meinungen aufeinander treffen. Mit ihren unterschiedlichen...
“Deutschland ein Jahr nach der Bundestagswahl”
In dieser interdisziplinären Veranstaltung befassen sich deutsche und internationale Journalist:innen und Wissenschaftler:innen mit der populistischen Beeinflussung von demokratischen Prozessen: sei es durch verschiedene Formen gezielter...
Das Team